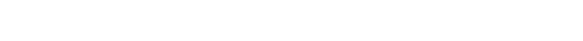Adolf Schlatter: Leben, Werk, Wirkung
Inhaltsverzeichnis
Professor für systematische Theologie in Berlin (1893–1898)
Im Jahre 1893 nahm Schlatter auf Bitten der preußischen Regierung einen Ruf nach Berlin an. Die Regierung war unter dem Eindruck des sog. „Apostolikumsstreites“ (1892) von kirchlichen Kreisen gedrängt worden, als Gegengewicht gegen die an der Berliner Fakultät vorherrschende liberale Theologie eine Professur einzurichten, die eine positiv-kirchliche Theologie repräsentieren sollte. Schlatters Startbedingungen in Berlin waren unter den gegebenen Umständen alles andere als einfach, da sich die Fakultät heftig gegen die neue Professur gewehrt hatte. Umso bemerkenswerter ist es, dass sich ausgerechnet zwischen Schlatter und dem berühmtesten seiner Berliner Kollegen, dem großen liberalen Theologen Adolf von Harnack, ein nicht nur kollegiales, sondern ein ausgesprochen freundschaftliches Verhältnis entwickelten, obwohl die beiden sich nicht scheuten, auch ihre theologischen Differenzen offen auszusprechen. Bezeichnend für das offene Verhältnis zwischen den beiden Gelehrten ist jene Episode, als Harnack im Kreis von Fakultätsprofessoren erklärte: „Vom Kollegen Schlatter unterscheidet mich nur die Wunderfrage!“ und Schlatter temperamentvoll dazwischenrief: „Nein, die Gottesfrage!“1 Als Schlatter 1898 Berlin verließ hat Harnack seinen Weggang aufrichtig bedauert: „Ich vermisse Sie … und empfinde es als Lücke, keinen Fachgenossen neben mir zu haben, der mich durch Widerspruch nachdenklich macht“.2
Schlatter hatte in Berlin systematische Theologie zu lehren und las dort erstmalig „Christliche Ethik“ (1894). Seine Vorlesungen wurden von den Studenten als ungewöhnlich modern empfunden, da sie die ganze Front des säkularen Denkens abtasteten und um eine dogmatisch, ethisch und auch philosophisch verantwortbare christliche Alternative rangen.
Im Jahre 1897 begründete Schlatter zusammen mit Hermann Cremer die Zeitschrift „Beiträge zur Förderung christlicher Theologie“. Diese Zeitschrift war ganz bewusst nicht als Parteiorgan konservativer Theologen konzipiert, sondern sollte der ganzen Kirche dienen und eine Theologie fördern, welche die Erkenntnis der Kirche über den vorhandenen Bestand hinaus weiterführt und reinigt. Dass es Schlatter und Cremer nicht um eine bloße „Restauration“ des kirchlichen Bekenntnisses ging, sondern um dessen Weiterführung und gegebenenfalls Korrektur, zeigte bereits das erste Heft, das mit der Abhandlung „Der Dienst des Christen in der älteren Dogmatik“ einen ausgesprochen zukunftsweisenden Aufsatz und zugleich die wohl bedeutendste Untersuchung Schlatters aus seiner Berliner Zeit publizierte. In dieser glänzend geschriebenen Studie legte Schlatter durch eine eindringliche Analyse der lutherischen und reformierten Orthodoxie wesentliche Defizite der nachreformatorischen Theologie und Frömmigkeit offen (z.B. ein unzureichendes Verständnis von Theologie, Liebe und Heiligung und die Vernachlässigung von Mission und Laienaktivität). Seine Behauptung, dass diese Defizite z.T. bereits in Engführungen der reformatorischen Theologie begründet seien, versuchte Schlatter in späteren Veröffentlichungen (z.B. in seiner 1917 erschienenen Abhandlung „Luthers Deutung des Römerbriefs“) zu erhärten. Mit der Abhandlung über den „Dienst des Christen“ wollte er freilich nicht in erster Linie eine historische Analyse vorlegen, sondern beispielhaft jenes Ziel verdeutlichen, das seine eigene theologische Arbeit lebenslang bestimmte und dem nun auch die neue Zeitschrift „an erster Stelle dienen“ sollte. Eine „erneute, vertiefte Schriftlesung“, deren Absicht darin besteht, den „ganzen Inhalt der Schrift“ anzueignen, um so das reformatorische Erbe nicht nur zu bewahren, sondern auch zu erweitern und zu korrigieren.3 Für Schlatter war dieses Ziel gleichbedeutend mit einer „Vollendung der Reformation“,4 da es dem innersten Anliegen reformatorischer Theologie entsprach.
Gegen Ende seiner Berliner Zeit lernte Schlatter den „Apostel der Liebe“ und Leiter der Betheler Anstalten Friedrich von Bodelschwingh d.Ä. (1831–1910) kennen, mit dem ihn bis zu dessen Tod eine herzliche Freundschaft verband.
Trotz der beachtlichen Resonanz, die seine Lehrtätigkeit in Berlin erfuhr, fühlte sich Schlatter als naturverbundener Mensch in der Millionenstadt Berlin nicht besonders wohl, sodass er im Jahre 1898 gerne einen Ruf an die Universität Tübingen annahm: „Von meiner Studentenzeit her lag für mich auf Tübingen ein heller Glanz. Ich wurde gern Becks Nachfolger … Ich erwartete von Tübingen, dass es meine Wanderjahre beende, mir eine Heimat bereite, die mich vom Elend der Großstadt befreie, mir wieder am Himmel die Sonne und auf der Erde Hügel, Felder und Wälder zeige und mir einen Hörsaal verschaffe, in dem ein fruchtbarer Verkehr mit den Studierenden möglich war.“5
Vgl. dazu W. Neuer, Adolf Schlatter (s.o. Anm. 4), aaO, 307.
Brief Adolf von Harnacks an Adolf Schlatter v. 5.2.1899 (Adolf-Schlatter-Archiv Nr. 426).
Der Dienst des Christen in der älteren Dogmatik 93, in: A. Schlatter, Der Dienst des Christen. Beiträge zu einer Theologie der Liebe (hg. v. W. Neuer), Gießen/Basel 22002, 19–93.
Rückblick auf meine Lebensarbeit (s.o. Anm. 5), aaO, 47.
Ebd. 195.